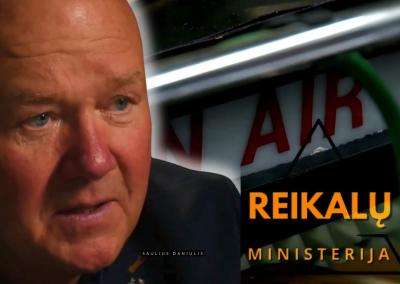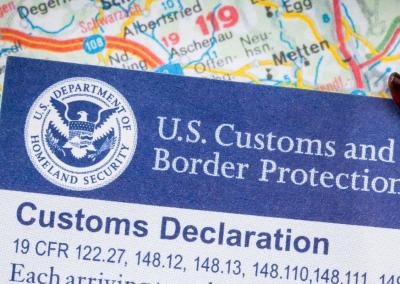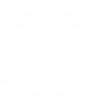Deutschland startet ein Projekt zur Wolfsjagd. Was schlägt der Gesetzgeber vor?
In den letzten Jahren haben die Entwicklungen in Europa zum Erhaltungszustand der Wölfe eine neue Welle der Diskussion ausgelöst. Die Erholung der Wolfspopulation in der Europäischen Union ist offensichtlich. Im Jahr 2023 wurden EU-weit schätzungsweise 20.300 Wölfe gezählt. Gleichzeitig hat sich ihr Verbreitungsgebiet auf rund 2,2 Millionen km ausgedehnt, wodurch die Berührungspunkte mit menschlichen Aktivitäten zunehmen.
Durch die steigende Zahl und die Nähe zu Haustieren und landwirtschaftlichen Herden werden Wölfe zunehmend nicht nur zu einer Erfolgsgeschichte im Naturschutz, sondern auch zu einem echten sozialen und wirtschaftlichen Problem. Studien zeigen, dass es bis 2022 mehr als 21 500 Wölfe in Europa geben könnte. Dies entspricht einer Zunahme von rund 58 % in den letzten zehn Jahren.
Die damit verbundenen Risiken, wie Schäden an Nutztieren und die steigenden Kosten für Schutzmaßnahmen, veranlassen die Mitgliedstaaten zunehmend, neue Regulierungsmaßnahmen zu erwägen.
In diesem Zusammenhang hat Deutschland einen wichtigen Schritt getan. Der Deutsche Jagdverband (DJV) bewertet in seinem Bericht vom 21. November 2025 den Referentenentwurf – zur Aufnahme des Wolfes in das Bundesjagdgesetz – als positiv, aber ergänzungsbedürftig. Der DJV weist auf einige zentrale Punkte hin. Quelle hier
>Zunächst betont der DJV, dass der Zeitpunkt der Bejagung an die Biologie und Sozialstruktur der Wölfe angepasst werden muss. Der Entwurf sieht eine Bejagung von September bis Februar vor, doch der IWV argumentiert, dass dieser Zeitraum die Familienstrukturen der Wölfe stören könnte. Als Alternative wird vorgeschlagen, die Jagdzeit für junge Wölfe auf die Monate Juni bis Oktober zu legen, wenn die Jungtiere zuverlässiger von den erwachsenen Tieren getrennt werden können. Ein solcher Ansatz ist nach Ansicht der Organisation für eine nachhaltige Bestandsregulierung und einen günstigen Erhaltungszustand unerlässlich.
Ein zweiter Bereich der Regulierung ist unabhängig vom Erhaltungszustand erforderlich, betont die Organisation. Dabei handelt es sich um die dauerhafte und unbürokratische Möglichkeit, jene Wölfe oder Wolfsgruppen zu entnehmen, die Haustieren direkt schaden. Die SBI ist der Meinung, dass die Staaten das Recht haben sollten, das ganze Jahr über auf Schäden zu reagieren, ohne lästige administrative Hindernisse.
Drittens geht es um die Notwendigkeit, dass künftige Regelungen in das bestehende Jagdrecht integriert werden und mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union in Einklang stehen, insbesondere wenn sich der Erhaltungszustand und die Kontrollmechanismen ändern.
Das von der MSRL vorgeschlagene Konzept fördert die biologische Unversehrtheit der Natur, den Artenschutz und den Ausgleich zwischen den Interessen von Haustieren und Landwirten. Es gleicht einem Drei-Ziele-Rahmen: Management der Wolfspopulation, Schutz der Landwirtschaft und Vertrauensbildung in der Öffentlichkeit.
Dieser kombinierte Text bietet sowohl einen europaweiten Realitätscheck über das Wachstum, die Verbreitung und die Risiken von Wolfspopulationen als auch spezifische deutsche Reaktionen und Initiativen. Wenn Sie es wünschen, kann ich einen zusätzlichen Block darüber vorbereiten, wie diese Trends für Litauen relevant sein können und welche Entscheidungen in unserem Land bereits getroffen werden.