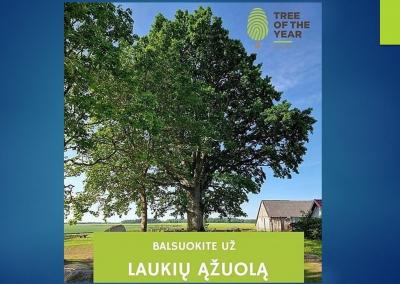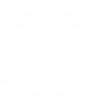Erwartungsdruck auf den Landmaschinensektor: Das CEMA-Barometer zeigt eine Verschlechterung der Stimmung
Die Stimmung in der europäischen Landmaschinenindustrie hat sich deutlich abgekühlt – der jüngste Bericht des CEMA-Geschäftsbarometers (Europäischer Verband der Landmaschinenhersteller) zeigt, dass der Gesamtindex des Geschäftsklimas im Oktober um 7 Punkte gesunken ist, von +11 auf +4 (auf einer Skala von –100 bis +100). Dies ist einer der niedrigsten Indikatoren in den letzten anderthalb Jahren und deutet darauf hin, dass der Sektor, der zuvor lange Zeit ein stetiges Wachstum aufwies, mit strukturellen Herausforderungen und einer geringeren Nachfrage konfrontiert ist.
Erwartungen bleiben, aber Marktdynamik lässt nachDer Bericht stellt fest, dass nur 32 % der befragten Hersteller die derzeitige Lage als „gut“ bewerten und 46 % erwarten, dass die Geschäftsbedingungen in den kommenden Monaten ähnlich bleiben oder sich verschlechtern werden. Der stärkste Rückgang wurde im Segment Traktoren und Erntemaschinen verzeichnet, wo die Unternehmen schwächelnde Aufträge und die Zurückhaltung der Landwirte bei Investitionen in Maschinen anführen.
Die Experten der CEMA betonen, dass dies kein Zeichen für eine Krise ist, sondern eher eine gesunde Abkühlung des Marktes nach mehreren Jahren sehr aktiven Wachstums.
„2021–2023 wurden Rekordumsätze mit Maschinen erzielt, so dass die Verlangsamung des Marktes im Jahr 2025 teilweise natürlich ist. Dieses Mal wird die Vorsicht jedoch nicht nur durch wirtschaftliche Faktoren, sondern auch durch strukturelle Veränderungen im energie-, regulierungs- und klimapolitischen Kontext angetrieben", so die CEMA in einer Erklärung.
Fünf HauptgründeIn dem CEMA-Bericht werden fünf Hauptgründe für die Abkühlung der Stimmung genannt. Erstens sehen sich die Landwirte in ganz Europa mit steigenden Produktionskosten konfrontiert, von Energie bis zu Düngemitteln. Viele haben Entscheidungen über den Kauf neuer Maschinen in Erwartung klarerer EU-Förderrichtlinien und gesetzlicher Änderungen bei den Emissionsanforderungen verschoben.
Die Hersteller stellen außerdem fest, dass sich die Lieferketten seit der Pandemie zwar stabilisiert haben, einige Komponentenbereiche, insbesondere Elektronik und Getriebe, jedoch weiterhin unter Druck stehen. Infolgedessen haben sich die Produktionszyklen für neue Maschinen verlängert und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist in einigen Regionen nach wie vor eingeschränkt.
Der deutsche und der französische Markt verzeichneten die stärksten Rückgänge im Auftragsvolumen, während die Situation in Polen, der Tschechischen Republik und Spanien relativ stabil bleibt. In den mittel- und osteuropäischen Ländern, einschließlich Litauen, verlangsamt sich das Tempo der Käufe in geringerem Maße, da die landwirtschaftlichen Betriebe noch von früheren EU-Projekten zur Entwicklung des ländlichen Raums profitieren.
Die Hersteller sehen sich jedoch mit einem erheblichen Investitionsdruck bei der Entwicklung von Elektrifizierung, Biomethanmotoren und autonomen Systemen konfrontiert.
„Jede neue Generation erfordert nicht nur technische Anpassungen, sondern auch Kapital. Daher drosseln viele Unternehmen derzeit das Entwicklungstempo", so die CEMA-Analysten.
Es ist auch bemerkenswert, dass die Zinsen in Europa nach wie vor hoch sind, was sich direkt auf die Verfügbarkeit von Agrarkrediten auswirkt. Nach Angaben der Finanzinstitute ist es für kleinere Betriebe wahrscheinlicher, dass sie ihre Maschinen länger behalten. Sie entscheiden sich eher für Reparaturen oder andere Anpassungen.
Mehr Vorsicht, aber keine Panik
Das CEMA-Barometer zeigt, dass die Einschätzung der aktuellen Lage immer noch positiv ist (im Durchschnitt +14 Punkte), aber der Erwartungsindex ist auf –6 gesunken. Das bedeutet, dass die meisten Hersteller für die nahe Zukunft einen schwächeren Absatz erwarten.
Große Unternehmen wie Fendt, CLAAS, New Holland, John Deere, AGCO Power investieren weiterhin in die technologische Entwicklung, verzögern aber die Einführung einiger Modelle. Anstelle einer aggressiven Expansion konzentrieren sich die Hersteller auf die Stärkung des Service und den Verkauf von Gebrauchtmaschinen.
„Die Technikhersteller tun jetzt das Klügste – es ist besser, die Entwicklung zu verlangsamen, als den Markt künstlich aufzublähen. Wir bewegen uns auf eine qualitäts- und effizienzorientierte Phase zu,– sagt CEMA-Generalsekretär Jérôme Bandry.
In Litauen macht sich diese Abkühlung des europäischen Sektors in abgeschwächter Form bemerkbar. Die größten lokalen Importeure berichten von einem Auftragsrückgang von etwa 10–15 %, betonen aber, dass die Nachfrage in den mittelgroßen Betrieben stabil bleibt. Einige Landwirte haben im Anschluss an die Subventionen 2023-2024 neue Maschinen gekauft und konzentrieren sich nun eher auf die Wartung als auf Neuanschaffungen.
Vor allem in den Segmenten Mähdrescher und Anbaugeräte ist das Servicevolumen nach wie vor hoch, so dass der Umsatz auch bei rückläufigen Neumaschinenverkäufen stabil gehalten werden kann.Die Ökonomen der CEMA prognostizieren, dass im Frühjahr 2026 eine moderate Stabilisierung einsetzen könnte, wenn die Agrarpreise stabil bleiben und die erneuerten Förderprogramme der EU an Fahrt gewinnen. Allerdings wird sich der Sektor auf neue Realitäten einstellen müssen: langsamere Investitionen, anspruchsvollere Finanzierung und technologischer Druck.
„Unsere Branche bleibt dynamisch, aber wir müssen uns an ein neues Tempo anpassen. Heute kommt es darauf an, das Vertrauen zu erhalten, die landwirtschaftlichen Betriebe zu unterstützen und klug zu investieren", so Bandry abschließend.>Das CEMA-Business-Barometer vom Oktober hat gezeigt, dass der europäische Landmaschinensektor nach mehreren Jahren rasanten Wachstums in eine "realistische" Phase eingetreten ist. Ein Wert von +4 ist kein Anzeichen für eine Krise, aber er deutet darauf hin, dass sowohl die Hersteller als auch die Landwirte ihren Schwerpunkt auf langfristige Planung, Effizienzsteigerung und vorsichtigere Investitionen verlagern.
In den kommenden Monaten wird sich der Markt nicht auf die Menge neuer Maschinen konzentrieren, sondern auf technische Zuverlässigkeit, Kraftstoffeffizienz und Nachhaltigkeitsanforderungen.