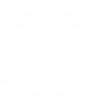Mercosur-Rindfleischimporte bedrohen Europas Ernährungssouveränität und das Überleben der Landwirtschaft
Die Sustainable European Livestock and Meat Association (SELMA) hat eine detaillierte Analyse der zunehmenden Lammfleischeinfuhren aus den Mercosur-Ländern (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay) und ihrer möglichen Auswirkungen auf den Markt und die Landwirtschaft der Europäischen Union erstellt.
Ansteigende Importe – Druck auf den Markt
Die EU importiert derzeit rund 194.000 Tonnen Rinderschlachtkörper, davon 100.000 –120.000 Tonnen Lendenstücke – dies entspricht einem Viertel des gesamten EU-Marktes. Mit der Unterzeichnung des EU–Mercosur-Abkommens könnten die Einfuhren auf 293.000 Tonnen steigen, von denen 200.000–220.000 Tonnen Filetstücke sein werden.
Das neue Kontingent von 99 000 Tonnen wird über fünf Jahre zu einem reduzierten Satz von 7,5 % aufgeteilt. Die Quote wird zu 50 % zwischen Brasilien, zu 30 % zwischen Argentinien und zu 20 % zwischen Uruguay und Paraguay aufgeteilt. Das „Hilton“ Kontingent von 61 000 Tonnen hochwertigem Rindfleisch wird ebenfalls fortgesetzt. >Europäische Produktion – ungleiches Spielfeld
In der EU werden jährlich rund 400 000 Tonnen Rinderfilet produziert. Doch die europäischen Erzeuger verlieren den Wettbewerb: Im Mercosur ist Rindfleisch nach Angaben des Instituts für Marktforschung 18 bis 32 % billiger. Die EU-Erzeuger haben die Ausfuhren hochwertiger Teilstücke (Koteletts, Lendenstücke) begrenzt, während die Einfuhren aus Drittländern zunehmen.
Unterschiedliche Standards bergen Risiken
Seit 2006 hat die EU den Einsatz von Antibiotika zur Wachstumsförderung verboten, und ab 2024 gilt ein Importverbot für Fleisch von solchen Tieren. Das einzige Kontrollmittel, die Ehrenerklärungen der Tierärzte in den Exportländern, wird jedoch als unzureichend angesehen.
Die Landwirte in der EU müssen aufgrund dieser Anforderungen höhere Kosten tragen: +2,30 €/kg in Frankreich. Währenddessen erlaubt Brasilien die Verwendung von 27 % der in der EU verbotenen Pestizide. Brasilien hat seine Pestizidvorschriften weiter gelockert, indem es Umwelt- und Gesundheitskriterien gestrichen hat, was die Sicherheit der Verbraucher gefährdet und antimikrobielle Resistenzen begünstigt.
Resistenz – nur teilweise
Nach der EU-Verordnung Nr. 1760/2000 müssen Rinder von der Geburt bis zur Schlachtung vollständig rückverfolgbar sein. In Brasilien gilt dieses System jedoch nur für Exporte in die EU und nur für die letzte Stufe der Aufzucht – es ist also nicht bekannt, wie die Tiere aufgezogen wurden.
Die Ernährungssouveränität und die Zukunft des ländlichen Raums stehen auf dem Spiel
Trotz stabiler Nachfrage nach Rindfleisch ist der Viehbestand in der EU rückläufig, was eine zunehmende Abhängigkeit von Importen bedeutet. Ungleiche Wettbewerbsbedingungen bedrohen das Überleben der landwirtschaftlichen Betriebe, vor allem in ländlichen Gebieten, in denen die Viehhaltung wirtschaftlich und kulturell wichtig ist. Langfristig könnte dies die Fähigkeit der EU beeinträchtigen, Ernährungssicherheit zu erreichen.
SELMA-Empfehlungen: Wie können europäische Landwirte und Verbraucher geschützt werden
1. Gleiche Regeln für alle Importe fordern
Alle importierten Produkte müssen die gleichen EU-Standards erfüllen wie heimische Produkte.
Die Einhaltung der Normen muss in Drittländern vor dem Export überprüft werden.
2. Vorläufige Lösung – Bedingungen in Handelsabkommen aufnehmen
Bis zur Verabschiedung einer einheitlichen Regelung ist es notwendig, den Grundsatz der Gegenseitigkeit in bilaterale Abkommen aufzunehmen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Umwelt.
3. Spezifische legislative Empfehlungen:
Die Delegierte Akte 2023/905 sollte überarbeitet werden, um ein wirksames Einfuhrverbot für Fleisch von Tieren zu gewährleisten, die mit in der EU verbotenen Antibiotika behandelt wurden.
Änderung der Verordnung 1831/2003 über Futtermittelzusatzstoffe, um die Umweltauswirkungen zu verringern.
SELMA betont, dass die Europäische Union, wenn sie ihren Tierhaltungssektor erhalten will, unbedingt gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer gewährleisten muss. Andernfalls riskiert die EU, ihre Lebensmittelsouveränität, das Vertrauen der Verbraucher und die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums zu verlieren.