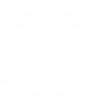Wie kann man Färsen und Kühe für die Zucht verantwortungsvoll auswählen?
Die Zucht auf dem Bauernhof wird oft als Selektion von Bullen verstanden. Mindestens die Hälfte der genetischen Information wird jedoch über die Mutter an die Nachkommen weitergegeben. Wenn wir uns also überlegen, welche Art von Herde wir in fünf oder zehn Jahren sehen wollen, lohnt es sich, zuerst zu prüfen, welche Kühe und Färsen wir für die Reproduktion halten.
Das Ziel der Selektion – ist nicht zu entscheiden, ob eine Kuh in der Herde bleiben wird, sondern ob wir ihre Tochter unter den zukünftigen Milchkühen haben wollen. Eine produktive, aber häufig behandelte Kuh mag heute wirtschaftlich lebensfähig sein, aber ihre Nachkommen könnten die gleichen Probleme vererben. Bei der Zuchtwahl geht es also nicht um die heutige Milch, sondern um die zukünftige Ausrichtung der Herde.
Wann sollte die genomische Auswertung eingesetzt werden?
Die genomische Bewertung bietet eine objektive Einschätzung des genetischen Potenzials einer Färse, bevor sie produktiv ist. Dies ist besonders relevant für Betriebe, die:
• geschlechtsspezifisches Sperma verwenden und planen, mehr Färsen zu produzieren als in der Herde verbleiben;
• auf bestimmte Eigenschaften abzielen (z.B. Fruchtbarkeit, Langlebigkeit);
• hat ein klar definiertes Zuchtziel.
In diesem Fall ermöglichen genomische Indikatoren die Eliminierung weniger vielversprechender Tiere vor der ersten Besamung – eine effizientere Nutzung der Ressourcen und die Vermeidung einer inkonsistenten Herdenbildung.
Wann ist eine genomische Untersuchung – keine notwendige Option?
Die genomische Auswertung ist ein nützliches Instrument, aber sie ist nicht in allen Betrieben notwendig oder wirtschaftlich sinnvoll. Wenn nur wenige Färsen geboren werden und fast alle in der Herde verbleiben, sind solche Tests oft von geringem praktischen Nutzen – es gibt ohnehin keine Wahl. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Betrieb kein klar definiertes Zuchtziel hat und genomische Daten ungenutzt bleiben. In solchen Fällen ist es sinnvoller, sich auf die Überwachung und Auswahl der wichtigsten Leistungsmerkmale auf der Grundlage der tatsächlichen Leistung und des Stammbaums zu konzentrieren.
Selektionsentscheidungen ohne genomische AuswertungAuch wenn keine genomischen Tests eingesetzt werden, kann die Selektion auf der mütterlichen Seite auf anderen Daten beruhen. Es lohnt sich, sich darauf zu verlassen:
• Leistungs- und Gesundheitsdaten – Langlebigkeit, Behandlungsgeschichte, somatische Zelldynamik;
&Rumpf; Kalbungsgeschichte – ob Hilfe benötigt wurde, ob es Komplikationen gab;
&Rind; Exterieur – insbesondere Euterstruktur, Beinstellung, Hufzustand;
• Abstammungsinformationen – Ergebnisse der Familienlinie, Merkmale der bereits vorhandenen Töchter.
Bei Färsen sagen die Merkmale und der Stammbaum der Mutter viel aus – dies hilft zu entscheiden, ob es sich lohnt, sie in die Milchviehvermehrung einzubeziehen, oder ob es besser ist, einen Fleischbullen einzusetzen und eine laktierende Kuh zu bekommen.
Selektion als strategischer Filter
Es ist wichtig, dass die Auswahl der Kuh nicht nur eine Frage des "Bauchgefühls" ist, sondern ein fester, strukturierter Bestandteil der Entscheidung. Dies kann formalisiert werden, indem man einmal im Quartal die Viehbestandsdaten überprüft, eine Selektionsliste für Färsen erstellt und festlegt, welche Färsen als Milchbullen und welche als Fleischbullen geeignet sind. Ein solches System trägt dazu bei, dass die Richtung der Herde nicht willkürlich, sondern konsistent ist.
Abschluss
Die Auswahl der Kühe für die Zucht ist keine Entscheidung darüber, wer gezüchtet werden soll, sondern eine Entscheidung darüber, wer seine Eigenschaften an die zukünftige Herde weitergeben darf. Dieser Ansatz vermeidet nicht nur eine unhaltbare genetische Basis, sondern ermöglicht es auch, das Wachstum des Betriebs auf realistische Entscheidungen zu stützen, die sich in der Praxis bewährt haben. Denn bei der Zucht geht es nicht nur um die Besamung von Tieren, sondern auch um den Aufbau der langfristigen Architektur der Herde.
Dr. Donata Uchockienė, Beraterin für Milchviehbetriebe, UAB „Gameta LT“